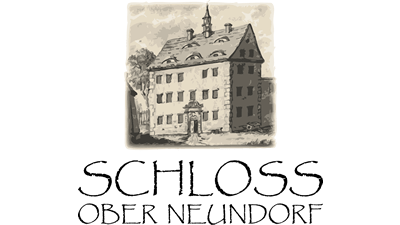1393–1412 | Peter von Kottwitz |
1412–1480 | Heinrich und Jan von Sar |
1480–1509 | Christoph und Jan Haugwitz, Heinrich Radehawe |
1509–1532 | Nukel und Geo…? von Gersdorff |
1532–1551 | Georg von Gersdorff |
1552–1580 | Anna und Abraham von Gersdorff |
1580–1591 | Georg von Salza zu Rengersdorf |
159 –? | Margarethe und Heinrich von Warndorf |
?–1604 | Nikol und George von Warnsdorf, Heinrich von Kheull, Christoph von Raussendorf |
1604–1608 | Heinrich von Salza |
1608–1649 | Kaspar III. von Fürstenau |
1649–1666 | Heinrich und Klaus von Taube |
1666–? | Marie Luitgard Vitzthum von Eckstädt |
?–1684 | Christoph III. Vitzthum von Eckstädt |
1684–1684 | Daniel Zobel, Bürger von Görlitz |
1684–1686 | Siegfried von Rabenau |
?-1700 | Gottlob Ferdinand von Uechtritz |
1700–1704 | Rosina Patientia von Gersdorff |
1704 -? | Johann Rudolf von Schönberg |
1723-? | von Gersdorff und von Sahla |
1743–1745 | Johann Gottlob und Christiane Erdmuth von Schönberg |
1745–1757 | Carl Joachim von Schmiskal und Domanowitz |
1757–1762 | Gattin des Carl Joachim von Schmiskal und Domanowitz |
1762–1768 | Johann Gottlob von Schönberg |
1768–1780 | Heinrich Siegmund von Schollenstern |
1780–1782 | Friedrich Gottlob von Wiedebach |
1782–1818 | Karl Gottlob (von) Anton (Mitbegründer der Oberlausitzschen Gesellschaft der Wissenschaften) |
1818–1822 | Ernstine Antonie Irmengard von Gersdorff, verw. Von Anton |
1822–1828 | Hermann Adolf Schneider |
1828–1833 | Ernstine Antonie Irmengard von Gersdorff, verw. von Anton |
1833–1840 | Carl Georg Emil von L´Estocq |
1840–1864 | August Theodor von Jordan |
1864–1907 | von Haugwitz |
1907–1911 | von Martin |
1911–1913 | Emil Mattig, Rentier in Görlitz |
1913–1945 | Olga Freifrau von Stein zu Kochberg (geb. von Foerster) Enteignung des letzten Eigentümers und Aufteilung des Grundbesitzes einschließl. der Hofgebäude auf Neubauern |
2001–2015 | Familie Gisbert Dahmen – Wassenberg |
Seit 2015 | Familie Kuhn |